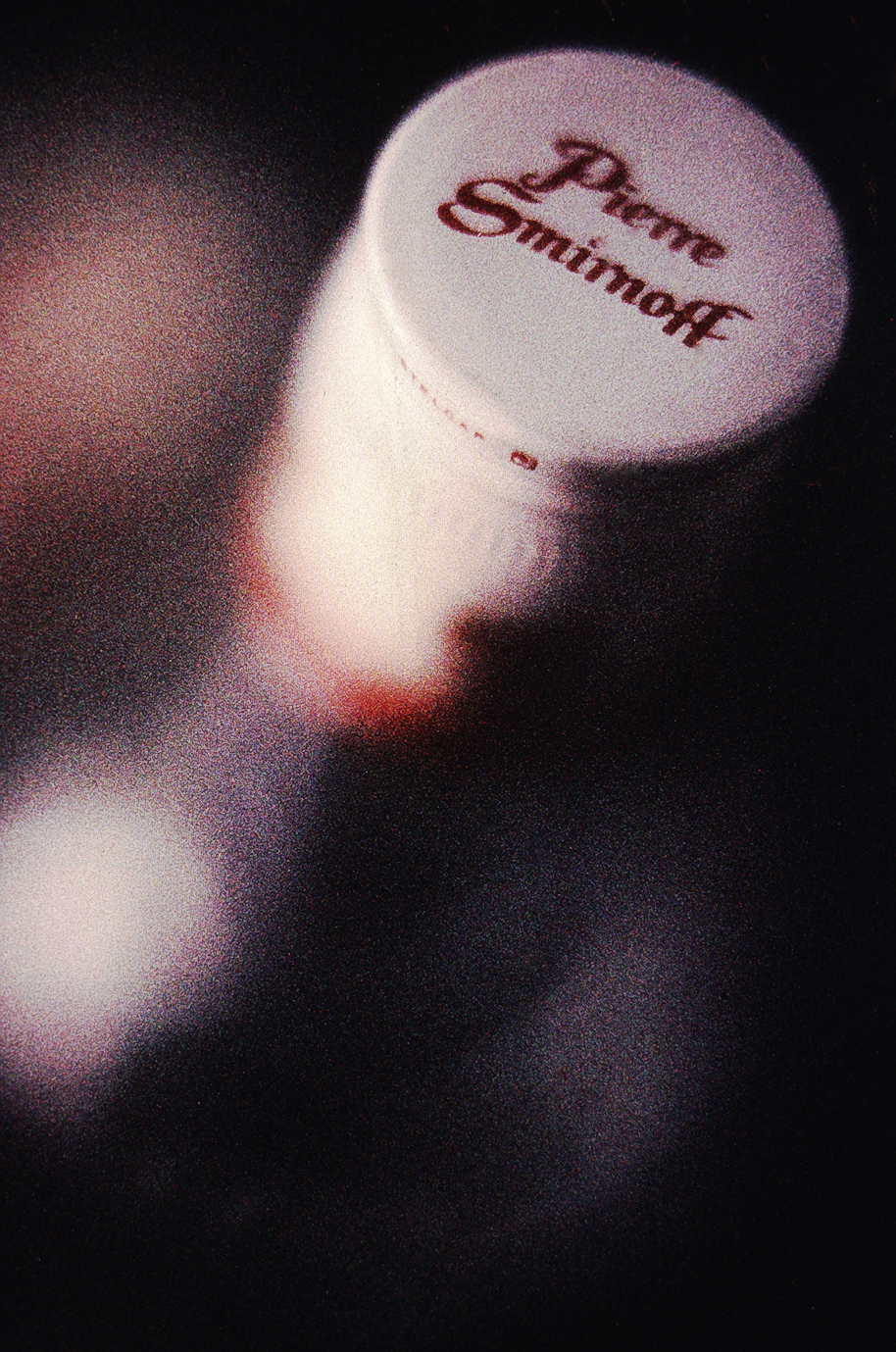Die Welt um uns ist nicht existent.
Weder Farbe noch Form, Licht und Schatten oder Temperatur existieren wirklich.
Die Welt ist eine Ansammlung von elektromagnetischen Schwingungen.
Unser Gehirn, gestützt durch seine Sensoren, macht sie zur Welt, in der wir leben.
Die Welt findet im Gehirn statt.
Sie ist ein Fantasieprodukt unseres Geistes.
Ein Morgen wie jeder andere, nur anders
Ich wache auf. Nicht weil ich will, sondern weil ein ratternder Müllwagen direkt unter meinem Fenster seine mechanische Kreissäge singt. Es riecht nach abgestandenem Kaffee, obwohl keiner gekocht wurde. Ein olfaktorischer Irrtum, der mich seit Tagen irritiert. Auf der Kommode steht eine halbvolle Flasche Rotwein von gestern Abend. Der Boden um mein Bett herum ist übersät mit Büchern, Notizen, und irgendwo dazwischen liegt meine Brille. Die Luft fühlt sich zäh an, wie ein schwerer Mantel, der nicht sitzt.
Ich schaue zur Decke. Da ist nichts. Kein Gedanke, kein Plan, nur das dumpfe Brummen eines leeren Kopfes. „So sieht’s aus“, sage ich in die Stille, aber meine Stimme klingt wie aus einem anderen Raum. Es dauert einige Minuten, bis ich mich aufraffe, die Füße in den Tag zu setzen.
Der erste Gang führt mich ins Bad. Der Spiegel zeigt einen Mann, der ein bisschen aussieht wie ich, aber irgendwie auch nicht. Die Augenringe könnten direkt aus einem expressionistischen Gemälde stammen. Die Zahnpasta ist fast leer, was mich an die Dinge erinnert, die ich schon ewig erledigen müsste: Einkaufen, Rechnungen bezahlen, endlich dieses Regal aufbauen. Aber wer hat dafür Zeit? Oder Lust?
Zurück in der Küche, schalte ich die Kaffeemaschine an. Ein müder Blick auf die Uhr. Sieben Uhr fünfundvierzig. Der Morgen zieht sich, während der Kaffee in langsamen Tropfen in die Kanne sickert. Die Sonne versucht zaghaft, durch die schmutzigen Scheiben einzudringen. Es gelingt ihr nicht wirklich.
Dann ein Klopfen an der Tür. Leicht, fast wie ein Zögern. Ich öffne. Da steht sie, in einem roten Mantel, den sie locker über den Schultern trägt. Lena. Natürlich Lena. Wer sonst?
„Hast du Kaffee?“ fragt sie, ohne Begrüßung.
„Noch nicht, aber bald“, sage ich, trete zur Seite und lasse sie herein. Sie bewegt sich durch den Raum, als gehöre er ihr. Lässt ihre Tasche achtlos auf dem Stuhl fallen, zieht die Schuhe aus und lehnt sich gegen die Arbeitsplatte.
„Du siehst beschissen aus“, sagt sie, während sie eine Zigarette aus ihrer Jackentasche zieht.
„Danke. Du bringst immer das Beste in mir hervor.“
Sie grinst, aber ihre Augen lachen nicht mit. Irgendwas ist anders heute. Ich weiß nicht, was es ist, und ich frage auch nicht.
Wir sitzen schweigend am Küchentisch, die Kaffeetassen dampfen vor uns. Ihre Zigarette brennt in der Aschenbecher-Tasse, die ich seit Monaten nicht mehr ausgeleert habe. Der Qualm mischt sich mit dem Geruch von verbranntem Kaffee und etwas anderem, das ich nicht identifizieren kann.
„Was machst du heute?“ frage ich schließlich.
„Was man eben so macht“, antwortet sie, zuckt mit den Schultern. „Arbeiten, leben, sterben.“
Es ist dieser trockene Humor, den ich an ihr mag und gleichzeitig hasse. Sie schafft es, selbst die banalsten Dinge wie ein Zitat aus einem Dostojewski-Roman klingen zu lassen.
„Und du?“ fragt sie zurück, ihre Augen fixieren mich plötzlich mit einer Intensität, die unangenehm ist.
„Weiß nicht. Vielleicht rausgehen. Oder was schreiben.“
„Schreiben.“ Sie lacht, kurz und scharf. „Worüber denn?“
„Keine Ahnung. Über dich vielleicht.“
„Über mich?“ Sie zieht eine Augenbraue hoch. „Da gibt’s nicht viel zu erzählen.“
Ich sage nichts. Sie irrt sich. Es gibt viel zu erzählen, vielleicht zu viel. Aber das ist nicht der Moment, das auszupacken.
Nach dem Frühstück – wenn man eine Tasse Kaffee und eine Zigarette so nennen kann – geht sie. Ohne Abschied, ohne Blick zurück. Nur das leise Klacken der Tür bleibt, und das Gefühl, dass sie ein Stück von sich hiergelassen hat.
Ich bleibe noch eine Weile sitzen, starre auf die leere Kaffeetasse und versuche, die Gedanken zu sortieren, die wie loses Papier durch meinen Kopf fliegen. Es gelingt mir nicht. Stattdessen ziehe ich mich an, schnappe mir die halbvolle Flasche Rotwein und gehe hinaus.
Die Straße ist laut und lebendig, aber ich nehme sie kaum wahr. Menschen, Autos, Hunde – alles zieht vorbei wie ein schlecht gemachter Film. Ich gehe, ohne ein Ziel zu haben, lasse mich einfach treiben. Irgendwann lande ich in einem kleinen Park, setze mich auf eine Bank und öffne die Flasche.
Der Wein schmeckt schal, aber das ist mir egal. Ich trinke, schaue den vorbeigehenden Menschen zu und denke an Lena. An ihren roten Mantel, ihre rauchige Stimme, die Art, wie sie die Welt mit einem einzigen Blick entwaffnet.
Die Sonne steht jetzt hoch am Himmel, aber sie wärmt nicht. Ein kalter Wind zieht auf, zerrt an den Bäumen und meinen Haaren. Ich ziehe meinen Mantel enger, nehme einen letzten Schluck und stehe auf.
„Vielleicht morgen“, sage ich leise zu mir selbst, als ich mich auf den Rückweg mache. „Vielleicht morgen wird alles anders.“